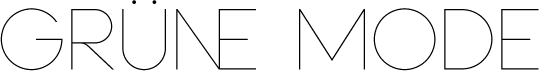25 Jan, 2012
Acht Fragen an das Lieblingsunternehmen
 Mark Starmanns & Kirsten Brodde
Mark Starmanns & Kirsten Brodde
Am 12. Januar 2012 meldete die Tagesschau, dass ein indonesischer Nike-Produzent rund eine Millionen Dollar für knapp 600.000 bislang unbezahlte Überstunden nachzahlen würde. Das wurde als Sensation gefeiert, denn in den meisten Niedriglohnländern verstößt die Bekleidungsproduktion täglich gegen geltende Gesetze und international anerkannte Menschenrechte – beim ökologischen Fußabdruck sieht es nicht besser aus.
Das muss aber nicht sein. Mit unseren acht Fragen weisen wir auf zentrale soziale und ökologische Herausforderungen in der Bekleidungsproduktion hin und zeigen zugleich, dass es immer Vorreiter gibt, die vorbildlich handeln. Warum nicht einmal seine Lieblingsfirma mit unseren acht Fragen konfrontieren?
1. Kennt das Unternehmen seine komplette Produktionskette?
Und wenn nicht? 2009 bekam der Timberland-Chef Jeff Schwartz über 65.000 Mails von Greenpeace-Aktivisten. Sie kritisierten, dass die Firma an der Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes mitbeteiligt sein könnte. Die Logik: Wenn das Schuhleder von Kühen stammt, für die der Regenwald gefällt wird, dann ist Timberland an der Abholzung des Regenwaldes beteiligt. Schwartz war zuerst schockiert über die Anklage, da er immer besonderen Wert auf die Umwelt gelegt hatte. Doch er tat alles, um die Herkunft des Leders herauszufinden – mit Erfolg.
Vorreiter wie Patagonias „Fooprint Chronicles“ oder Switchers „Respect-Code“ zeigen, dass Unternehmen durchaus ihre gesamten Produktionsketten kennen und veröffentlichen können. Patagonia weiß sogar, dass ein T-Shirt aus Bio-Baumwolle bei der Herstellung über 25.000 Kilometer zurücklegt – und dabei 4,7 Kilo CO2, 148 Gramm Abfall, 703 Liter Wasser und 12 kWh Energie produziert. Von der Energie kann eine 18W Birne 27 Tage und Nächte lang brennen. Und was geschieht mit den 30 Dollar, die das T-Shirt im Patagonia-Webshop kostet? Davon decken neben Patagonia mindestens sechs weitere Firmen in der Türkei, Indonesien, und drei in Los Angeles ihre Herstellungskosten ab. Auch der deutsche Staat bekommt rund 12 Dollar von jedem verkauften T-Shirt. Im Patagonia-Laden in Zürich kostet das gleiche T-Shirt dann übrigens 50 Dollar, wobei der Einzelhandel in der Regel mehr als 50 Prozent des Ladenpreises abschöpft.
2. Hat das Unternehmen hohe Arbeitsstandards für alle Herstellungsschritte festgelegt?
Über 75 Prozent der nach Deutschland importierten Bekleidung wird in Asien und Osteuropa genäht, wo die Arbeit billig ist und die Löhne kaum zum Leben reichen. Beispielsweise liegt der staatliche Mindestlohn in Bangladesch für eine 40-Stunden-Woche bei rund 30 Euro im Monat. Nach Recherchen der ARD kostest eine fünf Quadratmeter große Hütte in den Slums von Dhaka bereits 32 Euro im Monat. Damit sie überhaupt leben können, arbeiten viele 30 bis 40 Überstunden pro Woche. „Sonderausgaben“ wie Arztkosten, Schulgeld etc. kommen gar nicht in Frage.
Vorreiter schließen sich in glaubwürdigen Initiativen zusammen, die hohe Arbeitsstandards definieren und deren Umsetzung ermöglichen. Mitglieder der Fair Wear Foundation (FWF) müssen sich ernsthaft darum kümmern, dass in den Nähfabriken ein „existenssichernder“ Lohn gezahlt wird. Dieser erlaubt ohne Überstunden ein Leben in Würde. In Bangladesch liegt er bei mindestens 100 Euro im Monat. Doch auch bei der FWF geschieht die Umsetzung nur schrittweise. Immerhin kontrolliert die Initiative relativ glaubwürdig, ob die Mitglieder ihren Versprechungen Taten folgen lassen.
3. Sucht das Unternehmen gemeinsam Lösungen mit Konkurrenten und Kritikern?
Verbesserungen in Fabriken scheitern oft daran, dass jede Modefirma andere Standards verlangt. Fast jede Fabrik hat mehrere Auftraggeber, die verschiedene Arbeitsstandards fordern. Beispielsweise verlangt oft nur ein Auftraggeber die Zahlung von Existenzlöhnen – und die anderen gesetzliche Mindestlöhne. Diese eine Firma kann dann kaum menschenwürdige Löhne für alle ArbeiterInnen durchsetzen.
Vorreiter kooperieren: Sie schließen sich in Multi-Stakeholder Initiativen wie der Ethical Trading Initiative (ETI) oder der Fair Wear Foundation (FWF) zusammen und versuchen gemeinsam – auch mit Konkurrenten und Gewerkschaften – glaubwürdige Lösungen für die gemeinsamen Herausforderungen zu finden. ETI-Mitglieder Gap und Levi’s behaupten sogar, dass die Veröffentlichung von Fabriklisten im Internet solche Kooperationen einfacher mache.
4. Nimmt das Unternehmen die Bedürfnisse der ArbeiterInnen in der Fabrik ernst?
Um Arbeitsbedingungen in Fabriken zu überprüfen, schicken Modeunternehmen Auditoren in ihre Fabriken. Diese halten die Situation der ArbeiterInnen als Momentaufnahme in einem teuren Audit-Bericht fest. Auf dessen Grundlage werden Verbesserungsmaßnahmen festgelegt und später deren Wirkung evaluiert. Bislang führte H&M 2.000 Audits durch – und dennoch kippen die ArbeiterInnen bei H&M-Lieferanten in Kambodscha vor Erschöpfung immer wieder um. Was läuft da falsch? In den meisten Audits spielen die ArbeiterInnen eine Nebenrolle. Außerdem werden die meisten Audits von der Firma bezahlt, die kontrolliert wird, und die Ergebnisse darf niemand sehen. Hier ist fraglich, ob die richtigen Maßnahmen getroffen werden.
Aber es geht auch anders: Kleinere Firmen wie slowmo produzieren in Deutschland, wo die Probleme der Ausbeutung geringer sind. Andere Vorreiter versuchen, in ihren Fabriken folgende Situation zu schaffen: ArbeiterInnen wissen über ihre Rechte Bescheid und sie werden motiviert, sich über Verletzungen dieser Rechte zu beschweren, ohne gekündigt zu werden. Die Fair Wear Foundation und die Fair Labor Association bezahlen unabhängige Beschwerde-Manager, die im engen Kontakt zu den Arbeitern stehen und bei Problemen vermitteln. Besonders glaubwürdig sind Produzenten, die als Kooperative den ArbeiterInnen gehören, wie Nueva Vida Internacional, die für Zündstoff Bekleidung herstellt.
5. Hat das Unternehmen hohe ökologische Ziele definiert?
Wie viele gefährliche Substanzen in der Textilproduktion in den Produktionsländern Asiens eingesetzt werden, zeigte jüngst die Detox-Kampagne von Greenpeace. Teils waren hier auch Textilunternehmen betroffen, die ihrem Selbstverständnis nach bereits umweltfreundlich arbeiten. Untersucht hatte die Umweltorganisation nur ein umweltschädliches Kapitel der Textilproduktion, das Färben, Drucken und Ausrüsten (z.B. Imprägnieren). Das Drama beginnt aber schon auf dem Acker, wo etwa Baumwolle mit Pestiziden aufgepäppelt wird. Experten schätzen, dass für ein Kilo Textil bis zu sechs Kilo Chemie verwendet wurden – zwar sind viele Substanzen harmlos, ein kleiner Teil ist jedoch besonders gefährlich und vergiftet Menschen, Tiere und Umwelt.
Was tun die Vorreiter? Greenpeace setzt zunächst auf Negativ-Listen, auf denen die toxischen Substanzen stehen, welche komplett verboten gehören. Auch Bluesign, ein Standard für Kunstfasern, listet solche Substanzen auf. Umgekehrt regt das Cradle-to-Cradle-Modell an, überhaupt nur solche Chemikalien einzusetzen, die gut verträglich für Mensch und Umwelt sind. Eine solche Positiv-Auswahl liegt auch dem Global Organic Textile Standard (GOTS) zugrunde. Eine Positiv-Liste legt fest, was überhaupt und in welcher Menge an Chemie eingesetzt werden darf. Das fängt natürlich auch auf dem Acker an: Kontrolliert biologischer Anbau – sprich pestizidfrei – ist ein Muss.
6. Denkt das Unternehmen zirkulär?
Ein Modeunternehmen will möglichst viel verkaufen. Aber gerade die Menge der Kleidung, die produziert und getragen wird, macht das Problem. Weil die Kleidung so billig ist, wird sie bedenkenlos weggeworfen. Im Durchschnitt wirft jeder Deutsche jährlich 14 Kilogramm Kleidung weg. Getragen werden von dem, was wir im Schrank hängen haben, rund zehn Prozent. Der Rest setzt Staub an – sprich wir haben einfach zu viele Klamotten.
Was tun die Vorreiter? Im November 2011 schaltete Patagonia eine ganzseitige Anzeige in der New York Times: In großen Lettern steht dort: „DON’T BUY THIS JACKET“ – und darunter ein Patagonia-Bestseller. Was soll das? „Because Patagonia wants to be in business for a good long time – and leave a world inhabitable for our kids – we want to do the opposite of every other business today. We ask you to buy less and to reflect before you spend a dime on this jacket or anything else.“ Kreislaufdenken hat die Firma in vier Worte gepackt: reduce, repair, reuse, recycle.
7.Zahlt das Unternehmen faire Preise?
Über 85 Prozent der Baumwolle weltweit wächst in armen Ländern. Oft bewirtschaften Kleinbauern die Baumwolle und müssen von den Erträgen weniger Hektar Land überleben. Die persönliche Geschichte des 51jährigen Baumwollbauern Jalosi Patsani aus Malawi repräsentiert die Probleme vieler Bauern: Das Leben der siebenköpfigen Familie Patsani ist von Unsicherheit geprägt – sie bangt, dass es nicht zu viel und nicht zu wenig regnet, dass der Regen zur richtigen Zeit kommt, dass Schädlinge nicht die Ernte zerstören, dass alle Familienmitglieder gesund bleiben und er und seine Frau weiterhin hart arbeiten können etc. Patsani hat keine Information über Marktpreis oder Marktentwicklung. Er verkauft seine Baumwolle, sobald er sie geerntet hat. 2011 bekam er ca. 180 Kwacha (rund 80 Cents) für ein Kilo Baumwolle, hätte er ein paar Tage gewartet wären es 200 Kwacha gewesen. 2005 bekam er nur 22 Kwacha. In schlechten Zeiten kann er ohne die Hilfe seiner Nachbarn nicht überleben.
Was tun die Vorreiter? Wenn sie Baumwolle aus einem Entwicklungsland kaufen, dann kaufen sie ausschließlich Baumwolle, die den Bauern Mindestpreise garantiert, was bei „Fair Trade“ zertifizierter Baumwolle der Fall ist. Das Label der Fair Labeling Organisation (FLO) steht u.a. dafür, dass die Bauern einen Mindestpreis für ihre Ernte bekommen und dass sie sich in Kooperativen organisieren. Besonders löblich ist es, wenn eine Modefirma eine direkte Verbindung zu den Baumwollbauern aufbaut und versucht, diese langfristig zu unterstützen. Beispielsweise tut dies die Schweizer Firma Remei.
8.Steht das Unternehmen zu seiner Verantwortung?
Viele Firmen werben damit, dass sie Verantwortung übernehmen, obwohl sie das Konzept nur oberflächlich umsetzen – also „greenwashing“ betreiben. Beispielsweise warb Lidl 2010 auf Flyern, dass die Waren unter „fairen“ Arbeitsbedingungen produziert seien – und wurde dafür gescholten. Die Verbraucherzentrale Hamburg klagte mit Unterstützung der Kampagne für Saubere Kleidung und der ECCHR wegen Verbrauchertäuschung gegen den Discounter – mit Erfolg, denn es war klar, dass Lidl die Arbeitsbedingungen in Bangladesch nicht fair nennen konnte: Die Firma produziert einen Großteil der Textilprodukte in Bangladesch, aber verpflichtet die Lieferanten nicht einmal zur Zahlung eines Existenzlohns. Was war der Lerneffekt? Lidl spricht nicht mehr von „fairen Arbeitsbedingungen“. Nun heißt es: „Auch außerhalb Deutschlands engagieren wir uns in Zusammenarbeit mit der erfahrenen und renommierten Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) der deutschen Bundesregierung für Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern.“
Mittlerweile integrieren einige Firmen ihre soziale und ökologische Verantwortung für die gesamte Lieferkette ernsthaft in ihr Geschäftsmodell. In Deutschland ist sicher Hess Natur ein Pionier, aber auch viele kleinere Labels, die erst seit wenigen Jahren auf dem Markt sind. Eine vorsichtige Schätzung von Grünemode.de geht von über 100 Ökomode-Firmen aus, für die Ethik und Umweltschutz eine Selbstverständlichkeit ist. NETZWERK FAIRE MODE bloggt über Firmen, die soziale und ökologische Verantwortung ernsthaft in ihr Geschäftsmodell übernehmen. Der Blog wird gerade zu einem Online-Portal ausgebaut, das VerbraucherInnen beim schnellen Finden solcher Mode und Modefirmen vor Ort oder im Internet hilft und Transparenz zu den Herstellungsprozessen der Firmen schafft.
Wir danken Alex Vogt & Jana Kern für kritisches Feedback.
 |
Kirsten Brodde, Blog-Gründerin und Autorin von "Saubere Sachen", hat das Thema Ökomode quasi aus dem Nichts entwickelt. Sie arbeitet als Greenpeace Detox-Campaignerin bei Greenpeace Deutschland. Hier finden Sie alle Artikel von Kirsten . |
Veröffentlicht in: News