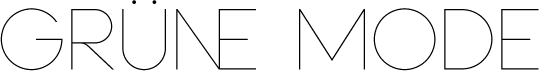21 Mrz, 2011
Von Heiden und Katholiken

Der Mann muss etwas loswerden. Er sei nicht gegen Ökologie. „A la long glaube ich daran, dass alles, was mit öko zu tun hat, sich durchsetzt“, sagt Karl-Heinz Müller gleich am Anfang des Gespräches. Das gelte auch für Mode. Kein „umsichtiges“ Modeunternehmen könne sich dem verschließen. Im Dezember vergangenen Jahres hatte der Chef der Bread&Butter in der „Textilwirtschaft“ noch gesagt, die Ökobewegung hätte keine „wirkliche Substanz“. Qualität, Wertigkeit und Niveau zählten viel mehr. Als schließe sich das aus. Im Blog wurde darüber heftig diskutiert und Karl-Heinz Müller meldete sich persönlich bei mir und bot ein Gespräch an.
Im März 2011 treffen wir uns endlich, in einem Showroom mitten in Hamburg, umgeben von Klamotten, was sonst. Karl-Heinz Müller redet gern Klartext, aber einen stählernen Blick oder eine kantige Brille braucht er dazu nicht. Er trägt Jeans und ein blau-weißes Karohemd, was locker über der Hose hängt. Dass er einer der Leitwölfe in der Modebranche ist, das reflektiert seine Kleidung nicht sofort. Aber ich trage ja auch keine Kartoffelsäcke, was mich sofort als „Öko-Nerd“ erkennbar macht, wie Karl-Heinz Müller die Anhänger der Ökomode durchaus liebevoll nennt. Die Ökomode-Messe „Key.to“ hat er mal als „Kindergarten“ bezeichnet – aber den hat man ja gerne in der Nachbarschaft, nicht wahr?
Es steht Wasser auf dem Tisch, die Stimmung ist aufgeräumt. Zumal uns offenbar beiden daran liegt, erst mal auszuloten, was uns verbindet. Davon gibt mehr in den nächsten anderthalb Stunden mehr als zu vermuten war. Denn die Bread&Butter in Berlin ist der Inbegriff einer überhitzten Branche, die laut, bunt und immer auf der Suche nach dem nächsten Kick ist. Nicht gerade meine spirituelle Heimat. Aber die Messe, mit der er sein Geld verdient. Und die der Branche suggeriert, es gäbe richtig was zu feiern.
Aber Müller passt sich nicht ein, schlägt gleich einen kämpferischen Ton an. Er schimpft auf Massenware, die in Discountern für zwei, drei Euro gekauft werde. „Für das gleiche Geld lasse ich meine Hemden in einer ordentlichen Wäscherei waschen“, spitzt er zu. Und schlägt die Brücke zu Lebensmitteln: Billige Käfigeier kaufe ja auch keiner mehr, sondern die teureren Eier aus Freilandhaltung. Da hätte sich bereits deutlich etwas getan – im Bewusstsein der Kunden und der Produzenten. Aber so einfach sei es halt in der Textilindustrie nicht.
Mehr Ethik – das sei aber auch das Gebot der Stunde in der Textilindustrie. Mehr noch als für Ökologie, interessiert sich Müller dafür, wie man zu „mehr Menschlichkeit“ in der Branche kommt, so dass jeder für seine Arbeit fair bezahlt wird. Er meint durchaus alle, die am Kleidermachen beteiligt sind: den Bauern, die Färber, die Näherin oder den Händler. Dazu brauche es eine hochpreisiges Produkt, was dann im Übrigen auch geschätzt würde und nicht mehr so schnell eingemottet. „In meiner Kindheit“, sagt Müller, „war eine neue Hose etwas Besonderes“. Nachhaltigkeit bedeute für ihn, „weniger Stücke zu konsumieren, dafür aber lange Freude zu haben an einem schönen Stück.“ Verbrauch ist eines der ganz großen Tabuthemen in der Mode – Müller spricht es an.
Ist das nicht widersprüchlich zu dem, was sich tatsächlich auf der Messe zeigt? Und ist die Bread&Butter nicht allein mit der schieren Menge, die dort ausgestellt wird, Motor einer Entwicklung, in deren Verlauf Kleidung mehr und mehr zum Wegwerfartikel verkommt? Ganz schlüssig sei das nicht, räumt Müller ein, aber in der L.O.C.K.-Area der Messe und und in seinem Laden 14oz. in Berlin zeige er die Label, die seine Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit erfüllten. Keine beliebigen Treter, sondern hochwertig gemachte Schuhe, keine gewöhnlichen Alltagsgewänder, sondern auf Handstrickmaschinen hergestellte Pullover oder eben Jeans, deren Denim noch mit den ursprünglichen Fertigungsmethoden auf schmalen Webstühlen hergestellt würde. Man merkt, dass hier sein Herz schlägt, den Umsatz macht er mit dem Rest.
Aber dahinter steckt ein Gedanke, der mir gut gefällt. Man braucht Crème-de-la-Crème, um den ganzen Krempel hinterher zu ziehen. Eleganter formuliert: Man braucht vorbildliche Marktsegmente, die die Branche vorantreiben. Ein Mann wie Müller könnte allerdings seine Spielräume weiter ausreizen und das, was er mir sagt, auch lauter gegenüber seiner Herde vertreten. Müllers Replik zum Thema: „Gehen Sie mal voran!“: Er finanziere jetzt ein eigenes „ehrliches“ Modemagazin unter dem Arbeitstitel „Berlin“, was im Sommer erstmals erscheine. Das treffe, wenn alles gut laufe, den Nerv und den Ton der Zeit besser als der Rest der Magazine.
In einem solchen Blatt ließen sich die guten Vorbilder, über die wir reden, durchaus hervorheben. Image sei alles in der Branche. Man müsse – so Müllers Kalkül – den Ehrgeiz der Labels anstacheln. Wenn jemand etwas ernsthaft Gutes (und Lukratives) habe, dann wollten die anderen es ihm gleich tun. Getreu dem Motto: „Was der kann, kann ich auch“.
Aber welche Marken könnten das aus dem Universum der Öko-Mode sein? Wer hat die Signalwirkung, die jemand mit Müllers Perspektive gelten ließe? Müller fällt nicht viel ein, was er für symptomatisch hält. „Viele der ausgewiesenen Ökomodemarken haben modisch noch große Defizite“, sagt er. Anders könne er sich die mikadodünnen Umsätze der grünen Mode nicht erklären. Ökologisch bewusste Verbraucher gäbe es genug.
Müller nennt nach einigem Nachdenken – und verständlicherweise – Marken, die auf der Bread&Butter ausstellen. „Nudie“ – die schwedische Jeansmarke – sei herausragend und eben auch eine Marke, der die Kunden Öko und Fairness glaubten. Nur die Oberteile hinkten optisch etwas hinterher, aber das sei bei „Jeansern“ generell so. Auch „Knowledge Cotton Apparel“ mache sich gut, was Aki Tuncer und die Familie hinter dem dänischen Label mit der Eule sicher freuen wird. Letztendlich sucht Müller – so verstehe ich es – nach einer richtigen Erdverschiebung – nach Sachen, an denen man nicht vorbei kommt. Davon würden dann seiner Meinung nach auch die vielen kleinen Kreativen in dieser Szene profitieren, die im Sog mit hochgespült würden. Nun, einen Hangar in Tempelhof kann man mit den Marken, die Müller spontan einfallen, noch nicht füllen. Aber das sieht die Ökomode-Branche eigentlich genauso.
Karl-Heinz Müller betont, dass vor allem die großen Marken gefragt sein, ihr Scherflein beizutragen. „Große Sünder, große Verantwortung“ – nenne ich das immer. Müller sagt es nur positiver, weil er Riesen wie Adidas, G-Star&Co. viel zutraut, vor allem die Power mal durchzuhalten, wenn es weniger gut läuft. Und er schreibt ihnen zu, dass sie sicherer sein, eine „modische Aussage“ der Kleidung hinzu bekommen.
Mogeln die Großen sich nicht gerne durch? Verbarrikadieren sich hinter ein paar Stücken aus Biobaumwolle? Womöglich – sagt Müller – werde sicher nicht alles „einwandfrei“ hergestellt, wohl aber „vernünftiger“. Diejenigen, die immer gleich kommen, es müsse alles 150prozentig sein, sind im suspekt. Er habe es satt, immer gleich als „Loser“ da zu stehen, wenn das Rundum-Sorglos-Paket in Sachen Öko und Fairness noch nicht da sei.
Müller rät den Großen der Branche, mal ein paar mehr dieser „Öko-Nerds“ einzustellen, damit die ihnen erklären, wie es geht. Womöglich wären diese Nerds – ich nenne sie Modemacher neuerer Prägung – auch schon einmal durch die Welt gereist und leibhaftig in einer echten Produktionsstätte. Müller blickt mich eher fassungslos an. Für einen Blick hinter die Kulissen, interessiere sich eigentlich keiner wirklich in der Modebranche. Nur einmal hätte er in seiner Karriere erlebt, dass ein Käufer nicht nur seine Geschichte von „Authenzität“ und „Vintage“ hören wollte, sondern auch die Maschinen sehen, auf denen gefertigt wurde und den Laden, wo das Ganze stattfindet. „There is still work to do“, steht auf einem der Plakate, die in meinem Büro hängen. Das gilt für die Modebranche offenbar auch.
Aber darf denn eigentlich jeder selbst bestimmen, was er unter Nachhaltigkeit versteht? Nein, sagt Müller. Es brauche Zertifizierungen und Kontrolle. Er hätte sogar einmal einen „Weißen Bären“ überlegt, der die bessere Mode auf der Messe auszeichne. Aber er habe davor zurückgeschreckt, „sich zum Richter aufzuschwingen“. Dahinter verberge sich eine Mammutleistung. Aber für die Kunden seien Zeichen wichtig. Der Endverbraucher müsse Ökologie und Fairness am Produkt „ablesen“ können.
Er grinst mich an und erklärt, Wächter wie ich sollten sowieso mal mehr mit „Heiden“ wie ihm reden und nicht immer nur mit den „Katholiken“, die eh schon bekehrt seien. Wenn wir gute Argumente hätten, dann würden die auch gehört, sagt er optimistisch. Nicht dass ich nicht wüsste, wie es sich anfühlt, als „Bordsteinschwalbe“ in der Textilindustrie unterwegs sein und ungefähr so beliebt wie die Steuerfahndung. Aber bitte. Heiden zu mir.
Zum Schluss trägt er mir den schweren Seesack mit den Sportsachen herunter, die ich dabei habe. Ganz Gentleman. „Kommen Sie wieder, wenn sie was haben“, sagt Müller. Kurz und gut: Ich Evangelin fand diesen Heiden sympathisch und interessiert an der Frage, was in Zukunft eigentlich eine Selbstverständlichkeit in sein sollte in der Modebranche. Vielleicht bin ich nicht naiv, aber er wirkte nicht so, als binde er sich nur die Schürze um und mache auf Hausmann, wenn Gäste kommen. Sprich: macht auf Öko, wenn ich antanze.
Mit unseren Widersprüchen leben wir beide. Er ist kein Gangster, ich bin kein Gänseblümchen. Sehen wir mal, wie wir gemeinsam auf den grünen Zweig kommen.
 |
Kirsten Brodde, Blog-Gründerin und Autorin von "Saubere Sachen", hat das Thema Ökomode quasi aus dem Nichts entwickelt. Sie arbeitet als Greenpeace Detox-Campaignerin bei Greenpeace Deutschland. Hier finden Sie alle Artikel von Kirsten . |